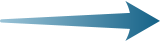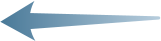Es ist schön und wichtig, dass wir wieder Gemeindegottesdienste feiern können. Weil der Glaube auch Gemeinschaft braucht. Und weil Gemeinschaft auch Halt
gibt. Aber ich will nicht mehr vergessen, dass der Gottesdienst ein Geschenk an mich sein soll und keine Leistung, die ich zu erbringen habe. Ich kann
den Menschen nur dann wirklich dienen, wenn ich mich von Gott beschenken lasse. Text: Thomas Binotto
Kräuter im Kloster Klatsch-Mohn
Morphin enthält der Milchsaft des Klatsch-Mohns nicht – im Gegensatz zu seinem grossen Bruder, dem lilablühenden Schlaf-Mohn.
Dessen Anbau ist aber aufgrund seines nicht nur
schlaf-, sondern je nach Dosierung auch
todbringenden Giftes bei uns verboten. Eine
beruhigende Wirkung hat ein Tee aus
Klatsch-Mohn-Blüten gleichwohl. Dazu übergiesst
man einen Esslöffel davon mit 250 ml ca.
60° C heissem Wasser.
Vor allem im Mittelalter wurde die Wirkung der
Pflanze wahrscheinlich wegen ihres
ursprünglich im asiatischen Raum beheimateten
Verwandten stark überschätzt. Heute
verwendet man die roten Blütenblätter in erster
Linie als Schönungsmittel in Tee-
Mischungen oder als Farbtupfer im Salat. Die Samen
sind eine beliebte Zutat in Broten und
Gebäck.
Von Mai bis Juli in Getreidefelder und an
Wegrändern wachsend ist der Klatsch-Mohn
ein Bote des Sommers. Er trägt Knospen, Blüten und
Samenkapseln gleichzeitig – und
überrascht mit Zahlen: Jede Blüte hat 164
Staubblätter, die 2,5 Millionen
Pollenkörner liefern, und in der Samenkapsel
reifen bis zu 20 000 winziger Samen
heran.
Das Gefäss der Kapsel versteckt sich
möglicherweise auch hinter dem ersten
Teil des lateinischen Namens. Der zweite trägt dem Umstand Rechnung, dass die Blütenblätter sehr schnell, oft bereits während des Pflückens abfallen. Der
erste Teil des deutschen Namens jedoch soll sich auf das Geräusch beziehen, das entsteht, wenn man durch ein Blütenblatt die Luft einsaugt.
Text: Alexandra Dosch, Dipl. Feldbotanikerin und Theologin